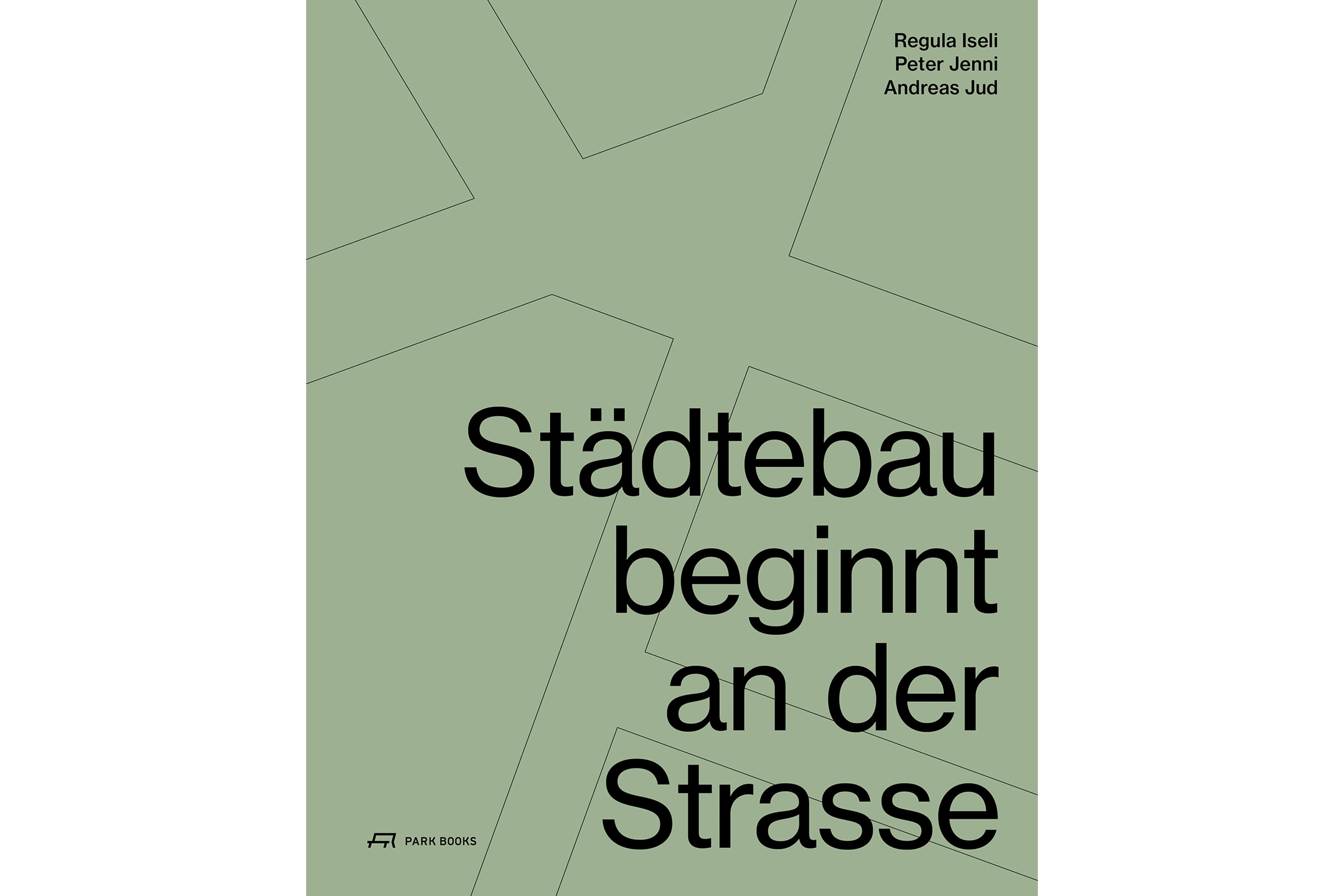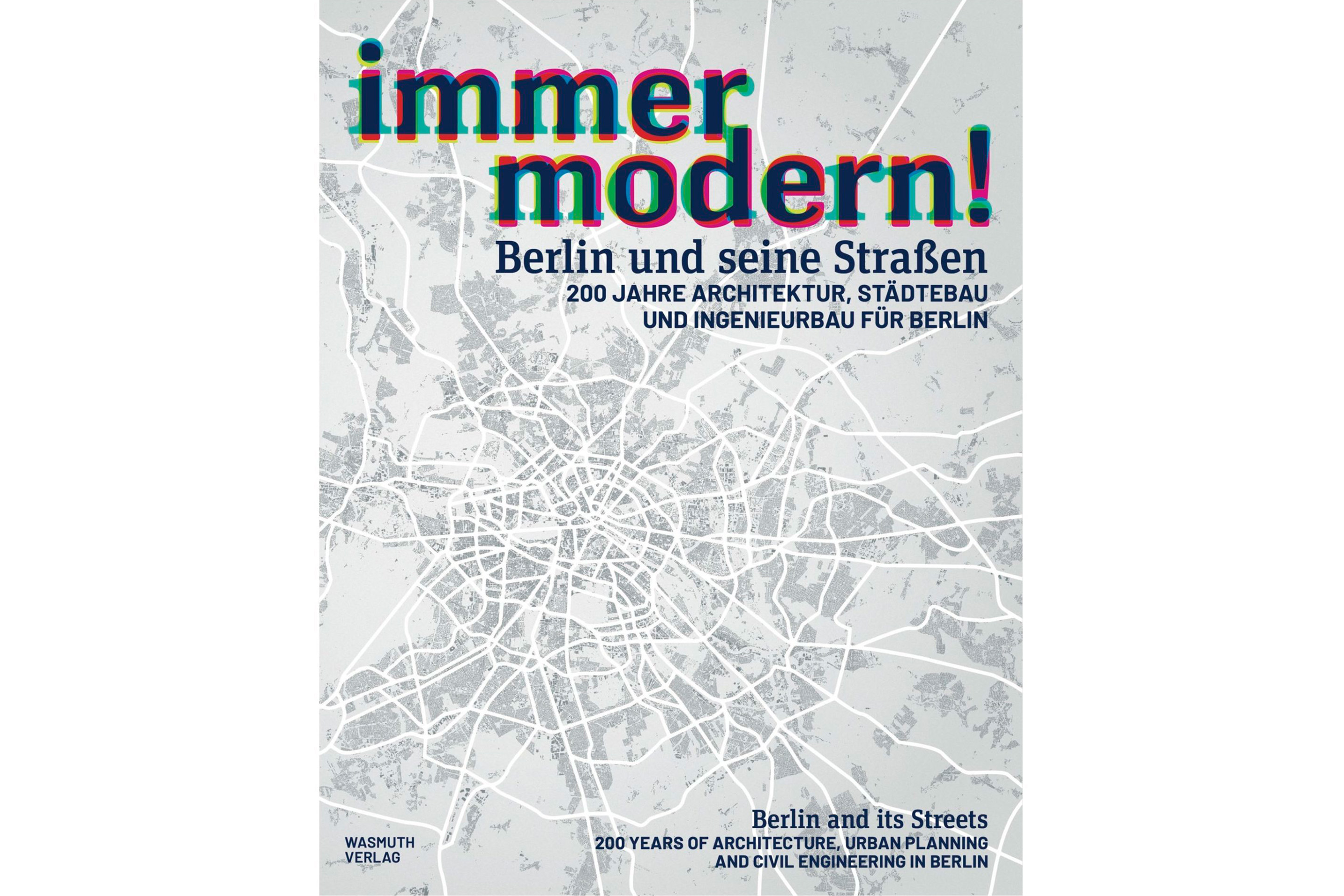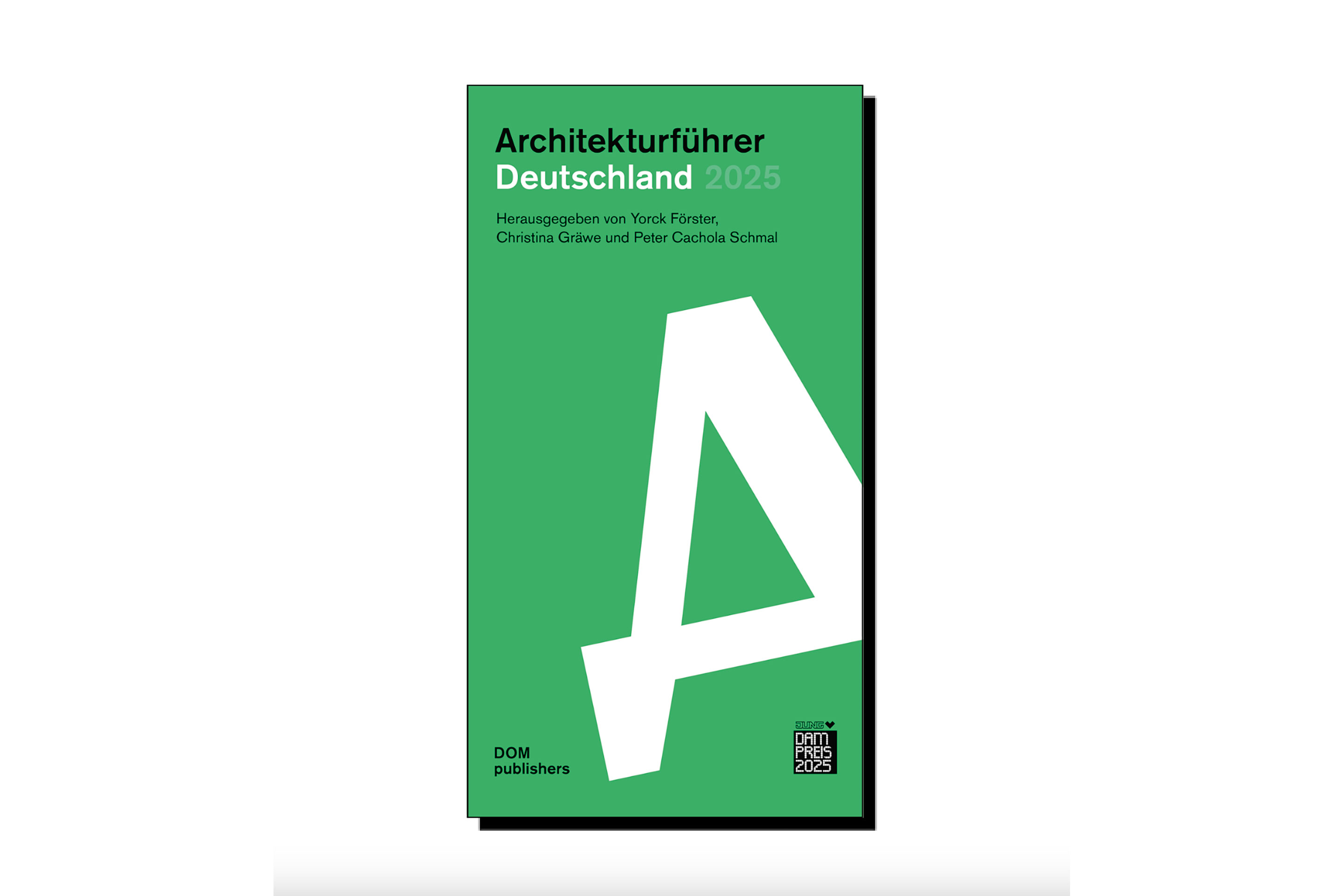Von der Badenerstrasse bis zum Kurfürstendamm
Die Verkehrswende und der Klimamandel erfordern es, Strassen neu zu denken. Aber wie? Zwei Bücher skizzieren die Ideengeschichte, Best Practice und Perspektiven qualitätvollen Städtebaus im Strassenraum – an Beispielen aus der Schweiz und Berlin.
«Was kommt einem, wenn man an eine Grossstadt denkt, als erstes in den Sinn? Ihre Strassen. Wenn die Strassen einer Grossstadt uninteressant sind, ist die ganze Stadt uninteressant …» Dieses Bonmot der Amerikanerin Jane Jacobs, in der Nachkriegsära legendäre Wegbereiterin der modernen Stadtsoziologie, findet sich in dem Buch über die Gestaltung von Strassenräumen «Städtebau beginnt an der Strasse».
Will sagen: Es gibt in der heutigen Stadtplanung keine grundlegendere und zugleich komplexere Aufgabe als die Gestaltung von Strassenräumen – denn schon quantitativ machen sie 80 % des öffentlichen Raums von Städten und Dörfern aus. Zugleich kumulieren sich hier vielfältige Zielkonflikte: Die Strasse ist Funktionsraum des Verkehrs und soll zugleich Aufenthaltsqualitäten besitzen.
Der Strassenraum, lange einseitig vom Auto dominiert, wird vielerorts neu verteilt mit mehr Raum für Velofahrende und Fussgänger. Doch damit fangen die Probleme eigentlich erst an: Denn der mit dichten Reihen rot leuchtender Poller und Betonkonsolen massiv gesicherte Velostreifen kann das Erscheinungsbild einer Stadtstrasse gründlich ruinieren.
Landschaftsarchitekturbüros, die den Auftrag erhalten, Strassenräume zwecks Klimaanpassung grosszügig zu begrünen, stellen schnell fest, dass sich vor lauter unterirdischen Medien und planerischen Zwangspunkten kaum Standorte für die neuen Bäume finden.
Städtebau im Strassenraum ist nichts für Anfänger. Am Institut Urban Landscape der ZHAW Zürich hat man einiges an Expertise für diese Aufgabe gesammelt und so entstand das Werk der drei ZHAW-Lehrenden Regula Iseli, Peter Jenni und Andreas Jud. Seit kurzer Zeit gibt es dort neben dem bewährten «CAS Städtebau» ein Aufbaustudium «CAS Stadtraum Strasse», das ganz auf diese Aufgabe fokussiert.
Atmosphäre quantifizieren
Kernstück des Buchs ist der Abschnitt «Räumliche Qualitätsmerkmale», in dem Aspekte und Voraussetzungen funktionierender und lebenswerter Strassenräume zusammengetragen werden. Ein Blick auf jüngere Planungen in Schweizer Städten dokumentiert im Schlusskapitel, wie die Umsetzung gelingen kann und wo Herausforderungen liegen.
Es geht nicht zuletzt um viel Koordination und ein Verständnis der Haupt- und Nebenstrassen eines Ortes als durchgängig gestaltetes Raumnetz. Jede Veränderung an einer Strasse sollte in ein übergreifendes Raumkonzept eingebunden sein. Zum Beispiel als so genannte Strassenentwicklungszonen in Zonenplänen oder kommunalen Richtplänen.
Für zwölf Strassen in unterschiedlichen Orten der Schweiz machen sich die Autoren die Mühe einer vergleichenden Analyse – mit Fotografien, Querschnitt, Grundriss und Kennziffern. Von der Schwarzenburgstrasse in Köniz bis zur Badenerstrasse in Zürich. Strassenräume werden in ihren Eigenschaften auf diese Weise atmosphärisch-räumlich greifbar. Was den Erkenntnisgewinn angeht, verlangt es Planenden wohl einiges an Abstraktionsvermögen ab, um aus diesen Fallstudien Anhaltspunkte für eigenen Projekte abzuleiten.
Strassenräume in Berlin
In Berlin folgt die Anlage neuer Strassen seit Mitte des 19. Jahrhundert einem einheitlichen Schema: Beiderseits der Fahrbahn folgt ein Gehsteig, bestehend aus Gehbahn, Ober- und Unterstreifen. Im mosaikgepflasterten Unterstreifen säumen Bäume die Strasse, in Berlin sind es traditionell Linden. Die Gehbahn besteht einheitlich aus diagonal verlegten Kunststeinplatten, in historischen Bereichen aus massiven Granitplatten.
Dieses Gestaltungsmuster prägt in seiner Einfachheit und Klarheit bis heute das Bild der Stadt – und ist eine bestens funktionierende Bühne städtischen Lebens, ganz im Sinne von Jane Jacobs. Zugleich sind diese Strassen so grosszügig dimensioniert, dass sie mühelos den «ruhenden Verkehr» von heute aufnehmen.
Der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin Brandenburg e.V. (AIV) brachte zum Anlass seines 200-jährigen Bestehens das Buch «Immer modern» heraus: Neun Autorinnen und Autoren skizzieren darin in exzellent bebilderten Essays die Verschränkung von Städtebau und Strassenplanung in der deutschen Hauptstadt. Der Blick richtet sich nicht nur auf Bekanntes wie den Kurfürstendamm, sondern auch auf Biografien wie jene der Swinemünder Strasse, an der entlang Markus Tubbesing die Städtebau-Leitbilder von 1860 bis 1980 erzählt.
Für den zweiten Teil des Werks wurden namhafte Architekturbüros gebeten, Entwürfe für die Neugestaltung wichtiger Berliner Strassen vorzustellen; ein Unterfangen, das nach der Buchpräsentation für Diskussionen sorgte. Denn ungeachtet manch unkonventioneller Idee zeigte sich, dass den Architekturschaffenden anders als den Landschaftsarchitekten und -architektinnen der Sinn für die räumlichen Regeln, die Grammatik von Strassenräumen vielfach fehlt.
So oder so ist das 440 Seiten starke Buch des Berliner AIV eine lohnende Ergänzung zum verdienstvollen Strassengestaltungs-Handbuch der Lehrenden aus Winterthur.
Regula Iseli, Peter Jenni, Andreas Jud (Hg.): Städtebau beginnt an der Strasse. Park Books, Zürich 2024. 168 Seiten, 203 farbige und 38 s/w-Abbildungen, ISBN 978-3-03860-351-1, Fr. 39.–
Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V., Tobias Nöfer (Hg.): immer modern! Berlin und seine Straßen. Wasmuth Verlag, 448 Seiten, 380 Abbildungen, ISBN 978-3-8030-2212-7, Fr. 60.–
Bücher bestellen unter order [at] staempfli.com (order[at]staempfli[dot]com). Für Porto und Verpackung werden Fr. 9.60 in Rechnung gestellt.